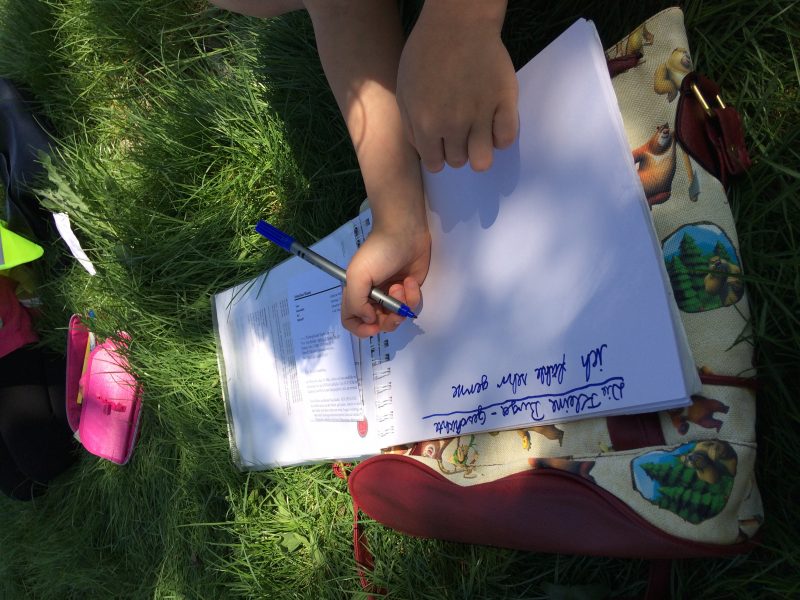Wir stellen unsere neuen Schauspielerinnen und Schauspieler im Ensemble vor. Heute: Lucas Janson, der seinen Einstand in Heilbronn in »Richard III.« und im »Dschungelbuch« gab.

In »Endstation Sehnsucht« stand Lucas Janson zum ersten Mal auf der Bühne des English Theatre in Frankfurt am Main. Da war er erst 15 Jahre alt und bemühte sich neben den ganzen Native Speakers mit seinem Schul-Englisch nicht ganz so verloren zu wirken. Und doch hat ihn dieses Erlebnis nachhaltig geprägt. »Sechs Wochen intensiv zusammen zu proben und dann gemeinsam einen Abend auf die Bühne zu bringen, das ist ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl«, sagt der junge Schauspieler. »Ich war auf der Suche nach diesem Gefühl – auch in meinem Beruf.« Seit September gehört er zum Ensemble des Theaters Heilbronn. Im Sommer hat er die renommierte Folkwang-Schauspielschule in Essen abgeschlossen.
Beeinflusst hat ihn auch die Arbeit seines Vaters, des Film- und Fernsehregisseurs Uwe Janson, an dessen Sets er einen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Als Jugendlicher stand Lucas auch mehrmals vor der Kamera z.B. in »Vulkan« an der Seite von Armin Rohde oder in der Märchenverfilmung von »Aschenputtel«. Aber das Dreh-Erlebnis war kein Vergleich zur Intensität der Theaterarbeit, beschreibt er.
Lucas Janson wollte sich durchbeißen, das Schauspielerhandwerk von der Pike auf lernen und bewarb sich an verschiedenen Schauspielschulen. Zunächst völlig naiv – ohne vorbereitete Rollen – hoppla, hier bin ich. Ganz klar, dass das erstmal nichts werden konnte. Aber die Absage von der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin hatte eine kathartische Wirkung, so dass er sich von da an mit großer Ernsthaftigkeit auf den Weg machte. Er ging zunächst zum Studium der Theater- und Medienwissenschaften nach Bayreuth, um sich theoretisches Rüstzeug zu holen. Anschließend begann er sich akribisch auf Vorsprechen vorzubereiten. »2013 habe ich an zehn Schauspielschulen vorgesprochen, war in mehreren Endrunden und hatte am Ende zwei Zusagen in der Tasche.« Unter anderem von der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin. Die Entscheidung für die Folkwang-Schule war eine echte Herzensangelegenheit, »weil die Dozenten dort wahrhaftig in 5 Runden testen, was man kann und an dem Menschen interessiert sind«. Außerdem hat er eine Vorliebe für den Ruhrpott und für Borussia Dortmund. Für Fußball interessiert er sich mit der gleichen Besessenheit wie für Theater. Wann immer es ging, hat er die Spiele seiner Lieblingsmannschaft im Stadion verfolgt und die unglaubliche Stimmung auf der Südtribüne genossen.
Nach vier Jahren Studium drängt es ihn auf die Bühne. »In den nächsten Jahren will ich mich zu 100 Prozent dem Theater verschreiben, lernen, mein Handwerk verbessern.« Seinen Einstand gab er in »Richard III.«, mit dem »Dschungelbuch« geht es weiter. Den erfahrenen Kollegen im Ensemble begegnet er mit viel Respekt und findet es großartig, dass Leute wie Nils Brück und Stefan Eichberg so uneitel von ihrem Wissen und Können an ihn als Anfänger weitergeben. »Man fühlt sich gut aufgehoben in diesem Ensemble«, sagt er. Und er ist froh, dass er auch schon eine alternative Szene in Heilbronn ausfindig gemacht hat – gar nicht weit weg vom Theater im Data.