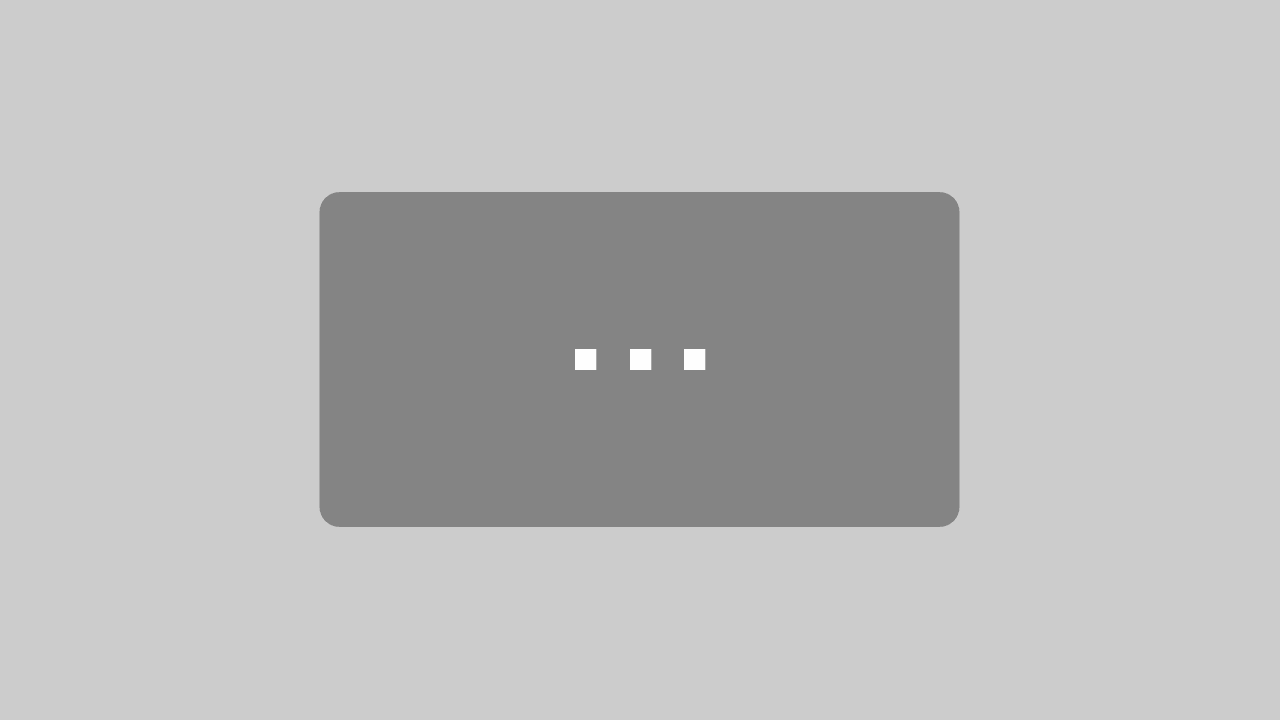Der Schwarze Rollkragenpullover lenkt den Blick auf das Wesentliche – den Kopf
Schwarzer Rollkragenpullover, schwarze Hose, so sind Harry Haller, sein Alter Ego Hermine und die Unsterblichen, in »Der Steppenwolf« in der Inszenierung zu sehen.
Harry Haller ist ein familienloser, heimatloser, hochsensibler Intellektueller von annähernd 50 Jahren, dem alles Bürgerliche zuwider ist. In seinem Erscheinungsbild erkennen wir den Intellektuellen, den Künstler sofort, unterstrichen durch die Kleidung, die er trägt.

Was steckt dahinter, woher kommt dieses Bild, das wir der Figur Harry Haller zuschreiben?
Mit dem Leiter unserer Kostümabteilung blicken wir auf die Tradition, die dahinter steht, wenn wir uns entscheiden, Schwarz zu tragen.
Wer sich für Schwarz entscheidet, tut das heute oft aus ganz praktischen Gründen, sagt Manuel-Roy Schweikart. Denn Fragen wie: welche Farben kombiniere ich heute miteinander, ist die Farbe meiner Kleidung dem Anlass angemessen, stellen sich nicht. Schwarz passt immer. Schwarz war in der Bekleidung lange eine Farbe des Wohlstands. Sie wurde nur zu besonderen Anlässen getragen, erläutert Manuel-Roy Schweikart. Die Herstellung schwarzer Kleidung war ein teurer, aufwendiger Prozess. Ein tiefes Schwarz konnte nur durch mehrere Färbeprozesse erzeugt werden, nur Purpurstoffe waren teurer.
Die Verbindung der schwarzen Kleidung mit dem vergeistigten Menschen, hat ihren Ursprung in der spanischen Hofmode des 16. Jahrhunderts. In den schwarzen Roben mit ihren stark stilisierenden Formen verschwindet alles Körperliche und der Kopf des Trägers wird zum Zentrum, erklärt Manuel-Roy Schweikart. Dagegen kommt die anschließende Renaissancemode fast freizügig daher. Die tellerförmige Halskrause rückte nicht nur den Kopf als Sitz des Geistigen in den Fokus. Die sonst ausschließlich Schwarze Kleidung nivellierte das Körperliche bis zur Unsichtbarkeit. Bis heute stehen die Roben von Geistlichen und Juristen in dieser Tradition.
Zum Glück entwickelte sich auch das Tragen schwarzer Kleidung weiter. Der berühmte Sonntagsanzug, das Sonntagskleid blieben lange hochwertig, hochgeschlossen und zeitlos, denn oft waren dies die besten Kleidungsstücke, die zu jedem Anlass tragbar sein sollten. Oft wurden sie in den Familien weitergegeben oder vererbt.
In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts jedoch wird der schwarze Rollkragenpullover zu einem Statement der Intellektuellen und Künstler, um sich vom Establishment abzugrenzen. Denn Hemd und Krawatte gehörten zum offiziellen Dresscode. Mit dem Rollkragenpullover lenken sie den Blick wieder auf den Kopf.
Dies alles schwingt in dem Bild des Harry Hallers mit, wenn wir ihn auf der Bühne sehen und vor allem seinen Kopf wahrnehmen. Der hochgeschlossene schwarze Pullover und die schwarze Hose lassen die Figur vor dem schwarzen Hintergrund der Bühne zurücktreten. Der Intellektuelle wird für uns in diesem Kostüm deutlich erkennbar. Dass dahinter jedoch ein antiquiertes Modephänomen des 16. Jahrhunderts steht, dem das Streben nach Züchtigkeit und Unschuld zu Grunde liegt, dürfte dem »Steppenwolf« ebenso zuwider sein wie die bürgerliche Gesellschaft.